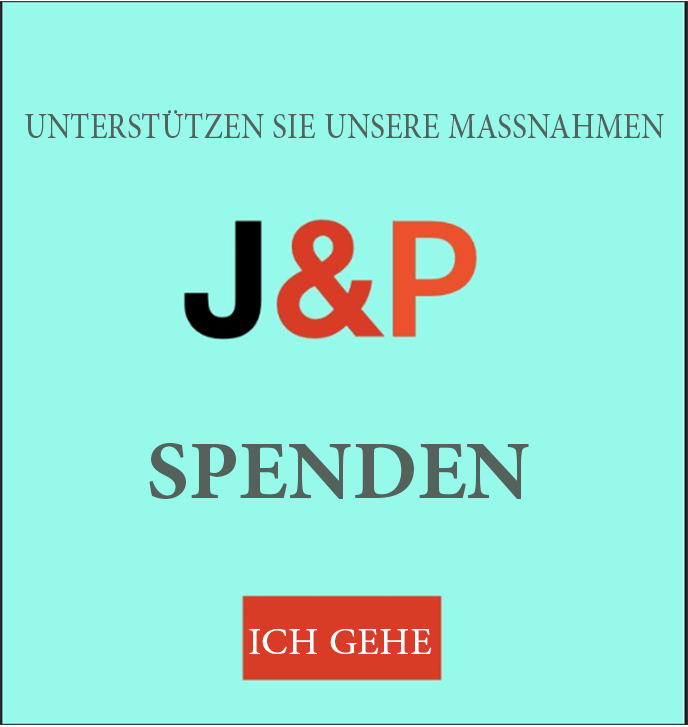Exklusivinterview mit Heza Botto: Schauspieler, Erzähler, Bürger Ein Schauspieler mit tausend Gesichtern und die Kunst des Engagements
Heza Botto verkörpert eine neue Generation von Schauspielern, für die Vielfalt nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Realität ist. Heza Botto ist eine der aufstrebenden Stimmen des zeitgenössischen Schauspiels mit seltener Eleganz. Zwischen einem vielfältigen kulturellen Erbe und dem Wunsch, universelle Geschichten zu erzählen, gestaltet er einen einzigartigen Weg, auf dem jede Rolle zu einer Erkundung wird.
Ein Treffen mit dem Mann, der in jeder Rolle das Unerwartete offenbart.
Der in Paris lebende französisch-kamerunische Schauspieler Heza Botto verkörpert kosmopolitische und engagierte Rollen, die seiner Filmografie entsprechen (u. a. Les Passagers de la Nuit (2022), Reine Mère (2024)). Er hat auch einen persönlicheren Kurzfilm namens "Are We Cool with This" ins Leben gerufen, der über Ulule finanziert und im September 2025 in Paris gedreht wurde. Dieses Projekt zeugt von seinem Wechsel zum Schreiben/Realisieren und seinem Engagement, neue Geschichten über das menschliche Dasein im urbanen Kontext zu Gehör zu bringen.
Jombelek: In "Are We Cool with This" erforschen Sie afrozentrierte Fragestellungen, während Sie durch eine lokale Erfahrung in Paris europäisch sind. Inwiefern betrifft dieser Blick uns alle, unabhängig von unserer Geografie?
Heza B.: Die Zeiten, in denen alle Menschen in einem Umkreis von 100 Kilometern geboren wurden, lebten und starben, sind weitgehend vorbei. Auf allen Kontinenten werden die ländlichen Gebiete zugunsten der Städte entvölkert. Dies ist eine erste Form der Migration und der Neudefinition der Identität der Betroffenen. Zweitens sind die Menschen international immer mobiler, sei es von den Ländern des Nordens in die des Südens oder umgekehrt. Diejenigen, die nicht reisen müssen oder können, sind über ihr Smartphone mit dem Rest der Welt verbunden. Das führt dazu, dass unsere Gedankenwelt, egal wo wir uns befinden, von dem beeinflusst wird, was auf der anderen Seite des Globus passiert. Das Lokale und das Globale verschmelzen bei vielen unserer Zeitgenossen miteinander. Ich hoffe, dass diese Geschichte die meisten von ihnen betrifft.
Jombelek: Wie stehen Ihre Welten beim Schreiben und Filmen dieser Geschichte miteinander im Dialog?
Heza B.: Ich bin Franko-Kameruner, aber alles in allem habe ich mehr Zeit in Europa gelebt als auf irgendeinem anderen Kontinent. Ich denke, dass sich dies in meiner Art, die Welt zu beobachten und sie wiederzugeben, bemerkbar macht. Aber da ich meine Gründungskindheit in Zentralafrika verbracht habe, habe ich im Vergleich zu einem "gebürtigen" Europäer einen verschobenen Blickwinkel. Darüber hinaus bin ich noch von anderen geografischen Räumen genährt, in denen ich gewohnt habe und die ich immer in mir tragen werde. Das bringt mich dazu, ständig nach Nuancen und Kontrapunkten zu suchen, nach einem Bereich, in dem die Standpunkte variieren und zum Ausdruck kommen, ohne sich gegenseitig zu überlagern. "Agree to disagree", wie die Angelsachsen sagen.
Jombelek: Europa erlebt sich oft als kultureller Kreuzungspunkt. Was verliert es Ihrer Meinung nach durch die Vereinheitlichung seiner Erzählungen und was könnte es gewinnen, wenn es sich mehr narrative Widersprüche erlauben würde?
Heza B.: Europa ist de facto ein kultureller Knotenpunkt. Manchmal freiwillig, manchmal gezwungenermaßen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Begriff der Vereinheitlichung der Erzählungen zustimme. Ich denke, dass Europa vor allem die Menschen sind, die hier leben. Unabhängig von ihrer Herkunft. Ob Angestellte, Künstlerin, Studentin, Einheimische, Exilantin oder Expat - jede Person bringt hier ihre eigenen Erzählungen ein und verbreitet sie. Die Empfänger dieser Geschichten können mit ihnen machen, was sie wollen: sie getreu reproduzieren, verändern oder vergessen. Solange sich Menschen bewegen (gegen alle Widrigkeiten und Grenzbeschränkungen), sind auch die Erzählungen - im Sinne von Niederschriften persönlicher Erfahrungen - in Bewegung. Damit es zu einer Vereinheitlichung kommt, müsste es Stagnation geben. Glücklicherweise sind wir nicht an diesem Punkt angelangt.
Jombelek: Wie verwandeln Sie als Schauspieler aus der Diaspora diese plurale Identität - die oft als gegeben hingenommen wird - in eine narrative Kraft, ohne sie zu einer künstlichen Rechtfertigung zu machen?
Heza B.: Indem ich mir diese Frage nicht allzu sehr stelle. Zu leben, indem ich mich in meinem sehr individuellen Paar pluralistischer Turnschuhe wohlfühle, ist der beste Schutzschild gegen Künstlichkeit. Und die beste Art und Weise, sich gegen die Anordnungen zu wehren, die von der einen oder anderen Seite kommen.
Jombelek: Was möchten Sie mit diesem Film in der kollektiven Vorstellungswelt ansprechen - oder verändern? Welche Zukunft oder welchen Schlüssel zum Verständnis schlagen Sie vor?
Heza B.: Ich möchte Zweifel aufkommen lassen. Meinungen oder Mentalitäten zu ändern, ist ein riesiges Projekt, das für meine bescheidene Person zu schwer ist. Ich würde mich schon freuen, wenn die Zuschauer den Saal mit einem neuen geistigen Fenster verlassen würden. Es geht nicht so sehr darum, das durchzusetzen, was ich für richtig halte. Vielmehr geht es darum, dass ein anderer Blickwinkel als meiner oder Ihrer, eine andere Erfahrung der Welt, unsere Aufmerksamkeit und unser Verständnis verdient. Selbst wenn dies nicht zu einer Änderung der eigenen Überzeugungen führt.
Jombelek: Die Nutzung von Ulule und Crowdfunding bezieht eine globale Gemeinschaft mit ein. Welchen Dialog möchten Sie mit den Unterstützern aufbauen, insbesondere über Frankreich hinaus?
Heza B.: Ich versuche, die Vielfalt der Unterstützer zu feiern. Die bisherigen Unterstützungen zeigen, dass das Thema auch außerhalb der afro-deszendenten und frankophonen Gemeinschaft Resonanz findet. Das berührt mich sehr und bestärkt mich in meinem Vorhaben. Was die Afrodiaspora speziell betrifft, so ist sie sprachlich nicht einheitlich. Neben den lokalen Sprachen sprechen die Nachfahren in Zentralafrika Französisch, die in Nordafrika Englisch oder Portugiesisch, am Horn von Afrika und in der Sahelzone wird u. a. Arabisch gesprochen. Wenn man miteinander diskutiert, muss man die lingua franca unserer Zeit verwenden, nämlich Englisch. Ich tue dies, indem ich die Rede für die Crowdfunding-Kampagne mit Untertiteln versehe.
Übrigens sprechen Rhokia und Nelson untereinander Englisch. Sie ist eine "Französin der zweiten Generation", wie es so schön heißt. Er ist ein englischsprachiger Afrikaner, der sich in Europa niedergelassen hat. Man ist versucht, eine natürliche Affinität zwischen ihnen zu vermuten. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass sie aus demselben Kulturkreis stammen. Sie müssen, wie jeder andere Mensch, der auf jemanden aus einem anderen Land trifft, einen Weg finden, ihre Erfahrungen miteinander zu verbinden. Der Engländer stellt sie auf den neutralen Boden aller globalen Austauschprozesse von heute. Ich hoffe, dass dies den Zuschauern helfen wird, sich die Geschichte besser anzueignen, egal wo auf der Welt sie sich befinden.
Jombelek: Glauben Sie, dass diese Geschichte, auch wenn sie in Paris verankert ist, aus einer afrikanischen Perspektive anders klingen kann? Was hofft sie, bei Zuschauern auf diesem Kontinent hervorzurufen?
Heza B.: Das Drehbuch ist in einem diasporischen und nicht in einem rein afrikanischen Kontext angesiedelt. Aber wie ich bereits sagte, haben die digitalen Werkzeuge die Entfernungen in unseren Köpfen schrumpfen lassen. Ich denke daher, dass ein Zuschauer in Dakar oder Kinshasa eine Verbindung zur Situation herstellen kann. Ich glaube, dass es eine Verbindung zwischen der Fluidität diasporischer Identitäten und der aus der Kolonialisierung resultierenden Hybridisierung gibt, die man herstellen - und mit Vorsicht handhaben - sollte, obwohl die beiden Dinge sehr unterschiedlich sind. Es ist jedoch möglich, dass die Pointe des Films einen Teil des Publikums mehr als den anderen vor den Kopf stößt, je nachdem, ob sie im Norden oder im Süden des Mittelmeers leben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Jombelek: Unser digitales Leben bringt uns gleichzeitig näher zusammen und schließt uns ein. Was erzählt die Promiskuität der sozialen Netzwerke über unsere Zeit?
Heza B.: Seitdem Handys mit dem Internet ausgestattet wurden, habe ich immer darauf geachtet, dieses Objekt dort zu lassen, wo es hingehört: so weit wie möglich in der hintersten Ecke meiner Tasche oder meines Rucksacks. Ich bevorzuge eine direkte Beobachtung der Welt und den Austausch mit allen Arten von Menschen. Natürlich freue ich mich über das kleine Pixelfenster, das mir die Möglichkeit bietet, Schnappschüsse der Welt zu sehen, zu denen ich sonst keinen Zugang hätte. Aber ich bin sehr misstrauisch gegenüber Algorithmen und dem Bestätigungsbias. Es tötet die Neugier, die Offenheit gegenüber anderen und die Möglichkeiten, neue Facetten von sich selbst zu erspähen. Und das Schlimmste ist, dass sich dieser Bias im realen Leben in einer zunehmenden Polarisierung der Standpunkte niederschlägt. Auf einem Planeten, auf dem wir keine andere Wahl haben, als ihn in gegenseitiger Abhängigkeit zu teilen, ist das sehr bedauerlich.
Jombelek: Wie unterscheiden Sie in Ihrem Ansatz zwischen Inklusion und Oberflächlichkeit ("Erzählsuppe")? Behalten Sie die Einzigartigkeit in einer umfassenderen Erzählung intakt?
Heza B.: Ich denke, das ist eine Frage, die man eher dem Zuschauer als dem Autor stellen sollte. Ich hoffe, dass das Urteil milde ausfällt.
Jombelek: Wenn Sie von Yaoundé nach Paris reisen, haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihr Akzent oder Ihre Gestik zu einer eigenen komischen Figur wird, noch bevor Sie den Mund öffnen?
Heza B. : Die Plastizität des Geistes ist eine faszinierende Sache. Ich amüsiere mich immer darüber, wie mein Akzent oder meine Gestik je nach Ort und Personen mutiert, ohne dass ich es sofort merke. Wenn es eine Komik in der Sache gibt, dann ist sie nicht ganz freiwillig, aber sie ist weit davon entfernt, erlitten zu werden. Es sind kleine Komplexitäten, mit denen ich in aller Ruhe lebe. Wir kommen auf die Idee zurück, sich in seinen pluralistischen Turnschuhen wohlzufühlen.
Jombelek: Welche Art von Erzählung könnte in Gesellschaften, in denen das Intime überbelichtet wird, noch überraschen oder berühren, ohne in ein Übermaß an Enthüllung zu verfallen?
Heza B.: Was mir am Geschichtenerzählen gefällt, ist, dass es so viele Arten gibt, wie es Empfindlichkeiten gibt. Geschichten, die schamlos enthüllen, haben den Vorteil, dass sie uns einen ehrlichen Einblick in die Gedankenwelt der Figur oder des Autors bieten. Dies ist eine Chance, die Dinge besser zu verstehen, die nicht zu unseren intimen Erfahrungen gehören.
Zum Beispiel hat die Offenlegung von Intimitäten nach Meetoo die Welt bewegt, und mich gleich mit. Ich bin nicht gegen die Ausstellung von Intimitäten, solange sie einem Zweck dienen. Zensur oder Selbstzensur tragen nicht zum gegenseitigen Verständnis bei. Bodenloser Sensationalismus und sinnlose Gesten hingegen sind nutzlos.
Jombelek: Was würde passieren, wenn morgen künstliche Intelligenzen die meisten Drehbücher schreiben würden? Welche menschlichen Bereiche würden Ihrer Meinung nach unnachahmlich bleiben?
Heza B.: Unsere Sinne ermöglichen es uns, die Welt zu erfahren und in unserem Fleisch zu vibrieren. Die Wissenschaft hat noch eine Menge Arbeit vor sich, bevor sie dieses Geheimnis entschlüsseln und es der KI ermöglichen kann, es sich anzueignen. Wenn die Drehbücher mehrheitlich von der KI geschrieben würden, würde es nach heutigem Stand zu einer Verarmung, einer stärkeren Standardisierung des kreativen Schaffens kommen. Das ist meine Intuition (meine Beschwörung?) als Nicht-Experte auf diesem Gebiet. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass KI die Arbeit von Kreativen erleichtern kann. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass ich im Film "Matrix" zwischen der blauen und der roten Pille wählen muss: Ich schwanke zwischen der Bequemlichkeit der Matrix und der mutigen Freiheit der Realen Welt.
Jombelek: Wie sehen Sie Ihren Weg in den nächsten fünf Jahren?
Heza B.: Ich möchte weiterhin spielen. In audiovisueller Fiktion oder in der darstellenden Kunst, in so vielen Gebieten wie möglich. Ich entwickle auch weiterhin fiktionale Projekte, die bis dahin vielleicht das Licht der Welt erblicken werden. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass dies ohne den lebenswichtigen Beitrag meiner Tätigkeit als Schauspieler möglich ist.
Jombelek: Sie haben in überwiegend europäischen Erzählungen gespielt. Ermöglicht Ihnen dieses Projekt endlich, Ihr Schreiben in eine gemeinsame, vielleicht eher afrikanische Erzählung einzubetten? Planen Sie, in Afrika zu drehen oder zu koproduzieren?
Heza B.: An der Entwicklung der Kulturindustrie auf dem Kontinent, auf dem ich geboren wurde, teilzunehmen und dabei meinen Werten treu zu bleiben, wäre ein großer Erfolg. Dennoch habe ich keinen genauen Plan. Ich mache jeden Schritt so, wie er mir gerade in den Sinn kommt. Eines ist sicher: Ich muss noch viel darüber lernen, wie Filme gemacht werden, sowohl in Europa als auch in Afrika. Der Weg wird lang sein. Aber er zählt mehr als das Ziel, heißt es.
Jombelek: Wie würde ein Weltfestival der unsichtbaren Erzählungen aussehen und welche Art von Geschichten würden Sie dort vorrangig hören wollen?
Heza B. Ich sehe riesige Leinwände, die an allen Ecken und Enden der Welt aufgestellt sind und gleichzeitig auf den ganzen Planeten projiziert werden. Ich möchte dort Geschichten sehen, die unsere Gewissheiten erschüttern. Geschichten, die Empathie für das schaffen, was uns Angst macht oder was wir lieber ignorieren würden. Ich bleibe bewusst vage, was die Themen betrifft. Es gibt so viele, die es verdienen, erforscht zu werden...
Jombelek: Wenn die Diaspora einen neuen Gründungsmythos erfinden müsste, wer wäre ihr symbolischer Held und Feind?
Heza B.: Ich halte nicht viel von dem Begriff des Mythos. Ich misstraue ihm sogar. Ich sehe darin eine Art Kult des Goldenen Kalbs für den Teil Ihrer Leserschaft, der nur vage Vorstellungen von der Bibel hat. Ich ziehe dem Mythos die Realität vor. Die Realität von uns allen, die wir versuchen, einen Sinn in unserer Anwesenheit auf diesem blauen Ball, der sich um seine Sonne dreht, zu finden. Die Realität eines Gleichgewichts zwischen individuellen Bestrebungen und der Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln. Die unwiderlegbare Realität einer Welt, in der mehrere Diasporas zusammenleben und sich miteinander vermischen. Ich sehe darin nicht die Gefahr einer Uniformierung. Eher das Wirken dieser kreativen Transformation, die das Lebendige kennzeichnet.
Jombelek: Was geschieht mit einer Erzählung, wenn sie von einer Sprache in eine andere übergeht? Ist es ein Verlust, eine Bereicherung oder eine kreative Mutation?
Heza B.: Ich bin kein Konservativer. Das Leben ist Veränderung und Bewegung. Erzählungen sind selten unveränderlich. Seien wir also philosophisch und positiv: Entscheiden wir uns für den kreativen Wandel.
Jombelek: Welche zukunftsweisende Botschaft möchten Sie den Zuschauern - ob in Paris, Douala, Berlin oder anderswo - mit "Are We Cool with This" vermitteln? Welches Bild, welche Erinnerung sollen sie mitnehmen?
Heza B.: Noch einmal: Ich versuche nicht, zu überzeugen. Vielmehr möchte ich eine Diskussion anregen. In diesem Fall geht es um die Themen schwarze Identität, Männlichkeit und die Befreiung von Dogmen. Wenn einige Leute nach der Vorführung sagen: "So habe ich das nicht gesehen, aber ja, warum nicht? ", ist mein Ziel mehr als erreicht. Wenn Sie sich an Hezas Entwicklungsprojekt beteiligen möchten, können Sie dies über den folgenden Link tun:
https://fr.ulule.com/are-we-cool-with-this/
Interview geführt von Johanne-Eli Ernest Ngo Mbelek, aka Jombelek
Paris 14. September 2025
Kontakt: Jombelek@gmail.com